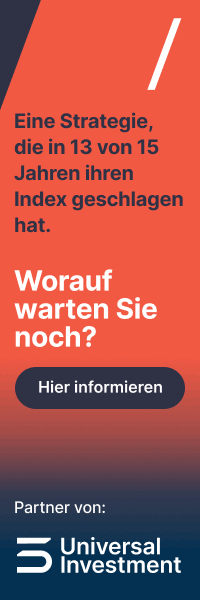Seit der Krise 2008 erholt sich die Wirtschaft nur sehr langsam vor allem dank der geldpolitischen Stimulation der Regierungen und Notenbanken. Doch diese Politik vernächlässigt die Ursachen der Krise und führt nur zu neuer Verschuldung. Ein Ausblick für 2016 von Axel D. Angermann.
Seit der Krise 2008 erholt sich die Wirtschaft nur sehr langsam vor allem dank der geldpolitischen Stimulation der Regierungen und Notenbanken. Doch diese Politik vernächlässigt die Ursachen der Krise und führt nur zu neuer Verschuldung. Ein Ausblick für 2016 von Axel D. Angermann.
Seit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2008 behandeln Regierungen und Notenbanken vor allem die Symptome der Krise, anstatt die Ursachen zu bekämpfen, die in einer viel zu hohen Verschuldung liegen. So wurde die Weltwirtschaft in den zurückliegenden Jahren durch massive geldpolitische Stimulation wiederholt auf Wachstumskurs gebracht.
Gleichzeitig ist damit eine Spirale sinkender Zinsen und weiter wachsender Verschuldung in Gang gesetzt worden. Zwar konnten seit dem Jahr 2011 größere Einbrüche vermieden werden. Doch der weltwirtschaftliche Aufschwung bleibt fragil. Je nach Regionen bestehen unterschiedliche Risiken, die den Erholungsprozess empfindlich stören können.
China: Gelingt der Umbau des Wachstumsmodells?
Mit zweistelligen Wachstumsraten schloss China im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts zu den führenden Wirtschaftsnationen auf. Der Boom beruhte allerdings maßgeblich auf konjunkturstützenden Maßnahmen der Regierung. Hohe Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsbau erwiesen sich mindestens zum Teil als massive Fehlallokationen.
Seit 2012 strebt die chinesische Führung deshalb eine wirtschaftliche Entwicklung an, die stärker auf dem privaten Verbrauch im Inland beruht und weniger von hohen Exportüberschüssen und Investitionen abhängig ist. Dies geht einher mit einem Zurückdrängen unrentabler staatlicher Unternehmen und einer Liberalisierung des Finanzdienstleistungssektors – letztere soll auch dem Yuan eine der Größe des Landes angemessene Bedeutung verschaffen.
Dieser Strukturwandel verläuft nicht reibungslos. Weil das von der politischen Führung ausgegebene Wachstumsziel von etwa 7 Prozent nicht zu erreichen ist, wurde es jüngst auf nurmehr 6,5 Prozent revidiert, was durchaus realistisch erscheint. Grundsätzlich geht hiervon das Signal aus, dass der Umbau der Wirtschaft nicht zugunsten eines stärkeren Wachstums zurückgestellt werden soll. Auch wenn die Senkungen des Leitzinses sowie des Mindestreservesatzes, die Lockerungen der Bedingungen für die Kreditvergabe und die Abwertung der Währung gegenüber dem US-Dollar keine durchschlagende Wirkung zeigten, verfügt die chinesische Führung weiterhin über wirksame geldpolitische und fiskalpolitische Instrumente, um einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aktiv zu begegnen. Die Gefahr eines Total-Absturzes ist daher begrenzt.
Schwellenländer: Die goldenen Zeiten kehren nicht wieder
Russland und Brasilien befinden sich derzeit in der Rezession. Auch in Südafrika, der Türkei und in Indonesien hat sich das Wachstum abgeschwächt. Diese Länder leiden als Exporteure von Öl und anderen Rohstoffen besonders unter der China-Krise und dem Preisverfall von Rohöl. Nachdem der starke Globalisierungsschub im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts und damit der Rohstoffboom abgeklungen ist, treten nun die strukturellen Schwächen der Schwellenländer deutlich hervor. In Brasilien etwa war der private Verbrauch von 2004 bis 2011 um jährlich fast 4,5 Prozent gestiegen, die Produktivität dagegen um fast 1 Prozent pro Jahr gesunken. Dies hat die Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Unternehmen geschwächt. In manchen der betroffenen Länder scheint die politische Führung zudem nicht in der Lage, die hohe Verschuldung abzubauen und die Weichen in Richtung höherer Produktivität zu stellen. Dementsprechend schwach wird das Wachstum in den Schwellenländern in der nächsten Zeit sein. Im Jahr 2016 dürfte es mit 4 Prozent kaum höher liegen als im Jahr 2015.
Euroraum: Temporäres Zwischenhoch
Mit Ausnahme Griechenlands befinden sich die Länder der Euro-Zone derzeit auf einem moderaten Wachstumskurs. Möglich gemacht haben dies vor allem zwei exogene Faktoren: der niedrige Ölpreis und der schwache Euro, der den Export beflügelt. Die einzelnen Länder des Euroraumes entwickeln sich dabei höchst unterschiedlich. Spanien etwa hat das Wachstum mit Reformen, insbesondere des Arbeitsmarktes, wieder angekurbelt. Seit dem ersten Quartal 2013 ist die spanische Wirtschaft zehn Quartale in Folge stärker gewachsen als im jeweils vorhergehenden Quartal.
In anderen wichtigen europäischen Ländern lassen die erforderlichen Strukturreformen hingegen auf sich warten. Insbesondere Frankreich ist nicht in der Lage, seinen staatlichen Sektor zurückzudrängen. Hier zeigt sich die Kehrseite der expansiven Geldpolitik der EZB: Die rekordniedrigen Zinsen erlauben eine weiterhin hohe Kapitalaufnahme und verringern den Anreiz, die Neuverschuldung zu begrenzen.
Weil in wichtigen europäischen Ländern Strukturreformen unterbleiben und auf die Einhaltung der Stabilitätsregeln kein Verlass ist, scheint für Europa ein japanisches Szenario am wahrscheinlichsten: Das Wachstum bleibt schwach und wird nur dank fortgesetzter monetärer Lockerungsmaßnahmen durch die EZB im positiven Bereich gehalten. Auch die Griechenland-Krise ist noch längst nicht überwunden. Dabei dürfte selbst ein Grexit keinen spürbaren Einfluss auf das weitere Wachstum im Euroraum haben. Anders verhält es sich mit einem möglichen Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. Dies hätte potenziell deutlich stärkere wirtschaftliche Folgen als der Grexit. Beide Vorgänge zeigen, dass EU und Europäische Währungsunion unter starkem politischem Druck stehen. Die Gefahr einer weiteren Erosion der Eurozone bis hin zur Möglichkeit eines Auseinanderbrechens ist nicht aus der Welt.
USA: Wie stark ist die Wirtschaft wirklich?
Die USA scheinen sich von den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise am besten erholt zu haben. Seit 2010 ging es mit der Wirtschaft kontinuierlich aufwärts. Das Wachstum ist mit aktuell 2,5 Prozent relativ robust. Gleichwohl ist der Ausblick getrübt. In den vergangenen Wochen sind nahezu sämtliche Konjunkturindikatoren negativ ausgefallen: Die Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung gingen zwei Monate in Folge zurück. Die Exporte sind wegen des starken Dollars seit längerem rückläufig, und die Auftragseingänge lassen keine Besserung erwarten. Zuletzt gingen auch die Einzelhandelsumsätze zurück. Da die Gewinne der Unternehmen ebenfalls seit einiger Zeit sinken, dürfte auch der Beschäftigungszuwachs schwächer ausfallen.
Nach sechs Jahren des Aufschwungs wäre ein Nachlassen der wirtschaftlichen Dynamik keine Überraschung. Der starke Dollar und die schwächere Nachfrage aus den Schwellenländern setzt den exportorientierten Wirtschaftszweigen zu. Der niedrige Ölpreis wirkt zwar positiv auf den privaten Verbrauch, macht aber das in den USA verbreitete Fracking deutlich unattraktiver und stellt viele Unternehmen vor ernsthafte Finanzierungsprobleme. Die US-Wirtschaft wird aufgrund dieser konjunkturellen Rückschläge im kommenden Jahr voraussichtlich nur um 1,5 Prozent wachsen – mehr als ein Prozentpunkt weniger als bislang angenommen. Dass die amerikanische Zentralbank vor diesem Hintergrund ihre Zinsen erhöhen wird, ist nicht zu erwarten. Derzeit spricht eher einiges dafür, dass die wirtschaftliche Schwächephase länger andauern und es auf absehbare Zeit gar keinen Zinsschritt geben wird.
Ein klarer Trend ist nicht in Sicht
Die hohe gesamtgesellschaftliche Verschuldung und die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Risiken in den einzelnen Weltregionen gefährden weiterhin den Erholungsprozess der Weltwirtschaft. Mit einer spürbaren Verbesserung der Lage ist 2016 deshalb nicht zu rechnen. Im besten Fall dürfte es bei einem moderaten und fragilen Aufschwung bleiben. Insgesamt kristallisiert sich zunehmend eine Situation heraus, in der sowohl Notenbanken als auch Regierungen kaum noch Handlungsspielraum besitzen, um auf einen neuerlichen wirtschaftlichen Abschwung angemessen reagieren zu können. Am anfälligsten hierfür dürfte der Euroraum sein: Anhaltend niedrige Inflationsraten und strukturelle, das Wachstum begrenzende Probleme innerhalb der Währungsunion könnten dazu führen, dass auch mit einer Verlängerung des laufenden Quantitative Easing-Programms kein erneuter Befreiungsschlag gelingt, weil maßgebliche Akteure den Glauben an die Wirksamkeit der EZB-Geldpolitik verlieren. Dies gilt umso mehr, wenn der Versuch einer weiteren Schwächung des Euro von anderen Notenbanken konterkariert wird und letztlich verpufft. Für die weitere Entwicklung ergeben sich daraus erhebliche Unsicherheiten, die klare Trends über längere Zeiträume nicht erkennen lassen.
Von: Axel D. Angermann
Quelle: DAS INVESTMENT.